PALLIATIVPFLEGE Wenn das eigene Kind stirbt, ist das für Mütter und Väter eine unvorstellbare Belastung. Wie sie die Betreuung in der Sterbephase erleben, beleuchtet erstmals eine schweizweite Studie.

Eltern von schwer kranken Kindern wünschen sich, dass Ärzte sie besser informieren und in Entscheidungen einbeziehen. Shotshop
Für die Eltern ist es ein Schock: Bei ihrem vierjährigen Sohn wird ein Tumor in der Wirbelsäule diagnostiziert. Eigentlich ist dieser gut behandelbar, sodass Aussicht auf Heilung besteht. Der Junge erhält auch sofort eine Chemotherapie. Doch diese wirkt nicht. Die Ärzte versuchen es mit anderen, aggressiveren Medikamenten – vergeblich. «Nach vier Monaten stand fest, dass wir den Krebs nicht besiegen können», sagt Eva Bergsträsser, Kinderärztin und Onkologin am Kinderspital Zürich. Ihr steht eine schwere Aufgabe bevor: Sie muss den Eltern sagen, dass ihr kleiner Sohn sterben wird.
Jedes Jahr sterben in der Schweiz zwischen 400 und 500 Kinder, zu einem grossen Teil an unheilbaren Krankheiten. Am häufigsten sind dies Krebserkrankungen, Herzfehler und Hirnschädigungen. Etwa 40 Prozent der betroffenen Kinder sterben bereits in den ersten Lebenswochen, weil sie zu früh oder mit schweren Fehlbildungen zur Welt gekommen sind. «Ein Kind zu verlieren, ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann», sagt Eva Bergsträsser. Sie leitet das Palliativteam des Kinderspitals Zürich, welches unheilbar kranke Kinder und ihre Familien betreut und bis zum Tod des Kindes begleitet – oft auch darüber hinaus. «Wie gut Eltern den schweren Verlust verarbeiten können, hängt auch davon ab, welche Unterstützung die Familie erhält», sagt Bergsträsser.
Ehrliche Kommunikation
Deshalb haben sie und weitere Forschende untersucht, wie todkranke Kinder während ihrer vier letzten Lebenswochen in Spitälern und anderen Einrichtungen, aber auch zu Hause, betreut werden (siehe Infobox). Das Forschungsteam des Kinderspitals Zürich und der Universität Basel befragte 149 Elternpaare, deren Kinder im Jahr 2011 oder 2012 gestorben waren. Waren die Eltern mit der medizinischen Versorgung zufrieden? Fühlten sie sich ausreichend unterstützt? Wurden sie in wichtige Entscheidungen mit einbezogen? «Insgesamt ist das Ergebnis positiv», sagt Eva Cignacco, Co-Studienleiterin und Privatdozentin am Institut für Pflegewissenschaft der Uni Basel. Besonders mit der Schmerztherapie und der Behandlung weiterer Krankheitssymptome ihrer Kinder waren die Eltern zufrieden. Defizite zeigten sich hingegen in anderen Bereichen. Insbesondere Eltern von Neugeborenen fühlten sich oft nicht genügend in Entscheidungen einbezogen (siehe auch Panorama-Seite vom 28. Mai 2016). Beispielsweise wenn es darum ging, ob bei einem schwer herzkranken Kind eine weitere Operation durchgeführt werden oder lebenserhaltende Massnahmen beendet werden sollten. Wichtig war den Eltern auch, dass Ärzte sie offen und ehrlich über das Schicksal ihrer Kinder informieren, anstatt um den heissen Brei herumzureden. Ausserdem empfanden sie es als Belastung, wenn das Pflegepersonal häufig wechselte.
Grosser persönlicher Einsatz
Das ist besonders in Spitälern der Fall, die keine spezialisierten Teams für Palliative Care von Kindern haben. Unter dem Begriff versteht man eine umfassende medizinische, aber auch seelische und soziale Betreuung. Derzeit gibt es nur drei auf Kinder spezialisierte Teams in der Schweiz: in Lausanne, St. Gallen und Zürich. Zu jenem des Kinderspitals Zürich gehören neben Ärztinnen und Pflegenden auch Psychologen und Sozialarbeiterinnen. Sie kümmern sich nicht nur um die kleinen Patienten, sondern auch um Eltern und Geschwister, manchmal über Jahre hinweg.
Das erfordert grossen persönlichen Einsatz. So macht Teamleiterin Eva Bergsträsser häufig Hausbesuche, auch mal mitten in der Nacht. «Es ist mir wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Familien einzugehen.» Diese schätzen das sehr – so wie die Familie des vierjährigen Jungen mit dem Tumor. Die Eltern wünschten sich, dass ihr Sohn seine letzten Lebenswochen zu Hause verbringen kann. Dort sei er am glücklichsten, sagten sie. Immer wieder besprach Bergsträsser mit den Eltern, welche medizinischen Massnahmen dem Jungen noch möglichst viel Lebensqualität schenken könnten, und stimmte diese mit der Kinder-Spitex ab. Als Lähmungen in den Beinen auftraten, weil der Tumor auf das Rückenmark drückte, bestrahlte man noch einmal. Das Kind konnte wieder laufen. Ein letztes Mal ging die Familie gemeinsam wandern, bevor der Krebs zurückkehrte. Wenige Zeit später starb der Junge. «Es ist für Eltern sehr tröstlich, wenn sie das Gefühl haben, dass alles Menschenmögliche getan wurde», sagt Bergsträsser.
Überfordertes Personal
Doch um eine optimale Betreuung todkranker Kinder zu gewährleisten, fehlt es in den meisten Spitälern nicht nur an Ressourcen, sondern auch an Knowhow. Das ergab eine Befragung von 48 Fachpersonen, darunter Pflegende, Ärzte, Psychologen und Seelsorger, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurde. Diese empfinden zwar die Betreuung von Kindern an deren Lebensende als eine wichtige und bereichernde Aufgabe. Doch der Grossteil von ihnen hat keine spezielle Ausbildung in Palliative Care und fühlt sich bei Entscheidungen sowie beim Umgang mit Eltern oft unsicher und überfordert.
Deshalb muss die Ausbildung von Ärzten und Pflegepersonal im Bereich Palliative Care für Kinder stärker gefördert werden, so das Fazit der Studienleiterinnen. Sie schlagen den Aufbau einer kleinen Zahl spezialisierter Teams vor, die neben der direkten Betreuung von Familien auch andere Spitäler und Einrichtungen beraten und aktiv unterstützen.
Handlungsbedarf sieht auch das Bundesamt für Gesundheit, das einen Teil der Studie finanziert hat. Zwar wurde in der «Nationalen Strategie Palliative Care», die bis 2015 lief, die allgemeine Palliativbetreuung in der Grundausbildung von Medizinern verankert. Doch künftig müssten die besonderen Bedürfnisse unheilbar kranker Kinder und ihrer Familien noch stärker berücksichtigt werden. Ob dafür weitere Palliative-Care-Teams eingerichtet werden, müssen allerdings die Kantone entscheiden.
Die meisten Kinder sterben im Spital
Die Studie «Paediatric Endof-Life Care Needs» liefert unter anderem erstmals Zahlen dazu, wo und wie unheilbar kranke Kinder in der Schweiz sterben. An der Studie nahmen 17 Spitäler, 20 Spitex-Organisationen und zwei Langzeiteinrichtungen teil. Nur etwa jedes fünfte Kind stirbt zu Hause, obwohl sich das der Grossteil der Eltern wünschen würde. Vier Fünftel sterben hingegen im Spital, meist auf der Intensivstation. Bei etwa 20 Prozent wird in den letzten 24 Stunden vor dem Tod ein Wiederbelebungsversuch durchgeführt. ho
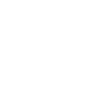


Keine Kommentare